
Psychische Störungen —
eine Epidemie des 21. Jahrhunderts?
Unlängst, als ich noch mich im Grundstudium der Humanmedizin befand, kam in der Psychologie und Soziologie Vorlesung die Frage, was wir für die häufigste Ursache von Arbeitsunfähigkeit in Deutschland vermuten würden. Die Top 3 Antworten, die wir gaben waren - Herzprobleme, Rückenbeschwerden und Erkältung. Das war total daneben! Wir haben nicht schlecht gestaunt als wir erfuhren, dass laut Statistiken der Krankenkassen, psychische Erkrankungen als ein nicht einholbarer Sieger die Liste anführen. Wo früher psychisch Kranke statistisch wenig waren, ist im 21. Jahrhundert dies eine zu häufige Erscheinung. Gründe dafür sind nicht nur ein besseres Verständnis und Weiterentwicklung der Psychologie und Medizin, sondern auch die soziologische und demografische Entwicklung unserer Gesellschaft.
Leistungsgesellschaft - ein Begriff das oft in aller Munde ist, gleichzeitig ein Begriff der zur gleiche Teile komplett falsch und eindeutig zutreffend interpretiert wird. Klingt ganz schön verwirrend, oder?

Wenn man etwas verstehen will, was in der Theorie logisch klingt, aber in der Praxis so gar keine Erfahrung empirisch beziffern kann, hat sich das Experimentieren als eine gute Möglichkeit erwiesen den Sachverhalt verständlich zu veranschaulischen. So würde ich Euch einen Experiment vorschlagen, das so einfach ist, dass man es vortlaufend anwenden könnte um das was ich behaupte zu belegen (oder widerlegen?).
Man stelle möglichst viele "normale" Mitmenschen aus möglichst unterschiedlichsten Alters- Sozial- und Berufsklassen die Frage, welcher der unten genannten Personen sie unter eideutig "psychisch krank", bzw- "psychisch gestört" einordnen würden.
Man beobachtet folgende Situation in der die betreffende Person:
a). ein Gespräch führt, mit jemand der nicht da ist , bzw. mit einer "imaginären" Stimme od. Person
b). ein Gespräch mit sein Haustier führt
c). mit seine Gartenpflanzen redet, während er diese pflegt.
d). mit sich selbst redet, oder sich selbst beschimpft /ggfls. lobt., sich Fragen stellt.
Was würdet ihr als Antwort da erwarten?
Bevor wir zu den möglichen Ergebnissen bei den obigen Experiment kommen, schauen wir uns vorerst wie die korrekte Definition von "Psychische Störung" lautet:
"Unter einer psychischen Störung versteht man eine deutliche Abweichung von der gesellschaftlichen oder medizinischen Normvorstellung psychischer Funktionen. Betroffen sind das Denken, das Fühlen und die Wahrnehmung, sowie potentiell auch das Verhalten. Sowohl die betroffene Person selbst, als auch die Umwelt können unter der Symptomatik leiden."
Quelle: DocCheck Flexikon

Das schwierige an der ganze Sache ist, dass die Definition eine Richtlinie für die Erkennung der typischen Merkmale darstellt, und keineswegs eine eindeutig abgrenzbare Definition. Denn die Ursachen dafür liegen meist an einem komplexen Zusammenspiel aus mehrerer Faktoren. Lediglich die organische Ursachen, und die chemischen Prozesse, die fehlerhaft ablaufen können faktisch durch bildgebende- und Labordiagnostik belegt werden.
Es ist aber in der Diagnosebezeichnung das Wort "psychisch" enthalten, was leider keine exakte wissenschaftliche Messungen sich unterziehen lässt. Das macht es umso schwieriger Betroffene Patienten korrekt zu therapieren.
Es stellt sich nun unvermeindlich folgende Frage:
Womit misst und vergleicht man die Symptome des Patienten um ihn die Diagnose - "psychisch gestört" zu stellen oder widerlegen?
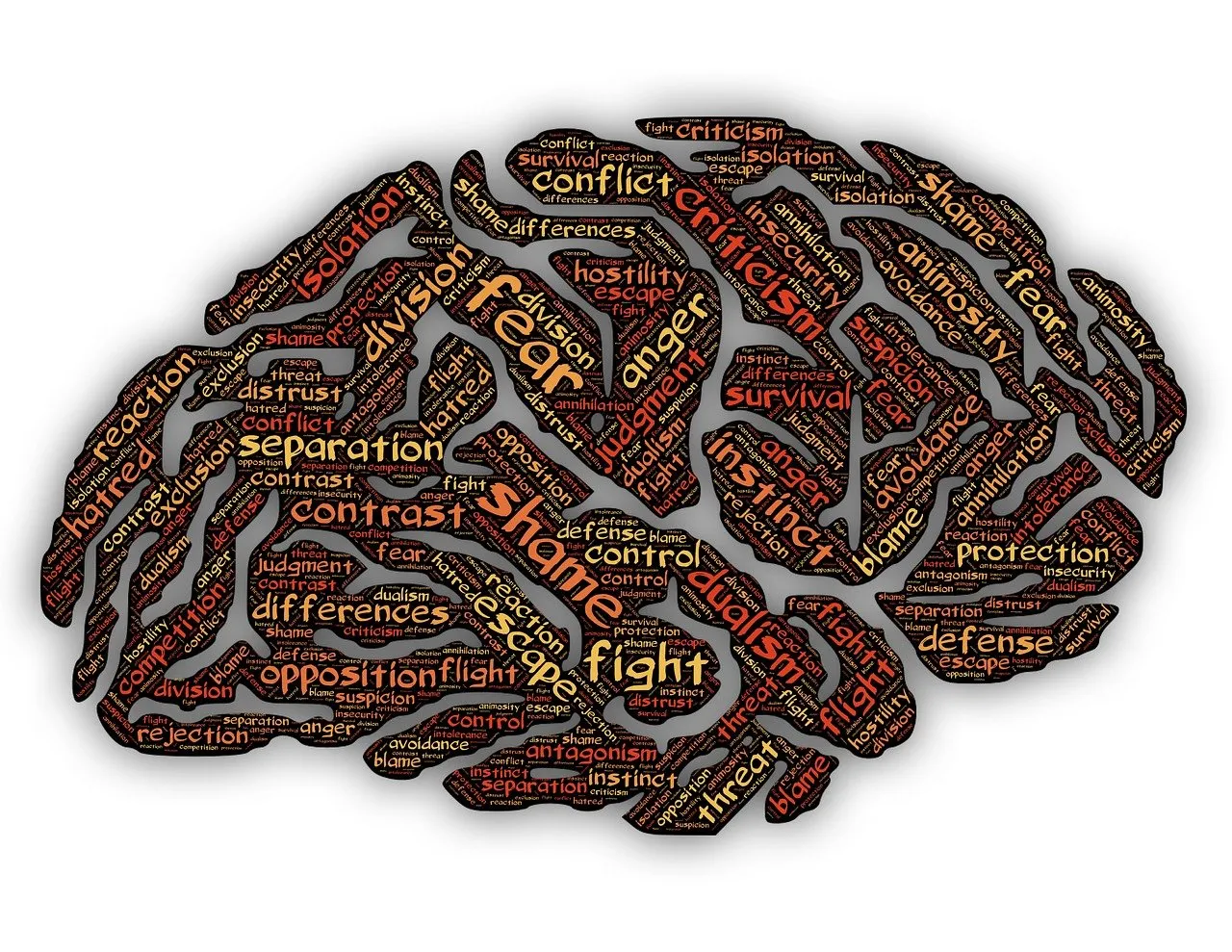
Nun, da kommen wir der Kern der Sache - auf die ich aufmerksam machen wollte ein Stück näher. Erstmal will ich kurz auf die Weiterentwicklung in der Medizin was die Begrifflichkeit des "Gesund seins" angeht hinweisen. Eigentlich ist das auch ein großes Thema, weil ich immer wieder im Berufsalltag feststelle, wie oft man an alte Normen festhält, aber das würde den Rahmen hier sprengen. Die Kurzfassung ist, dass es einerseits Gesundheit nicht nur körperlich - medizinisch definiert wird, sondern anders als im Mittelalter ond in den Anfängen der Forschungsmedizin, ist erst das harmonisch, gute Empfinden sowohl körperlich als auch geistlich als gesund angesehen. So ist es korrekt wenn man die Gesundheit über die Abwesenheit von Krankheit, oder den vom Patient selbst in zusamen übereinkunf der ärztliche Meinung mitbestimmten Zustand womit sich dieser gut, vollwertig und glücklich zufrieden selbst empfindet.
Der Knackpunkt ist aber derer dass die Gesellschaft enormen Beitrag beisteuert, ob und inwieweit jemand in seine freie Empfindung sich durch ein Verhalten was für ihn normal und angenehm empfunden wird, bei der Mehrheit als angepasst oder eher störend definiert wird. Allein 3 der 5 gewichtigsten Merkmale für die korrekte diagnostizierung einer psychischen Erkrankung sind nicht durch exakte Ergebnisse - wie Labor und Bildgebung belegbar und unterliegen daher der Einflüsse durch die in der Gesellschaft definierte Normen. Diese wiederrum werden stets durch die geschichtliche, demographische, technologische und kulturelle Entwicklung veändert und durch der Geist der emotionale Gegenwart diktiert.