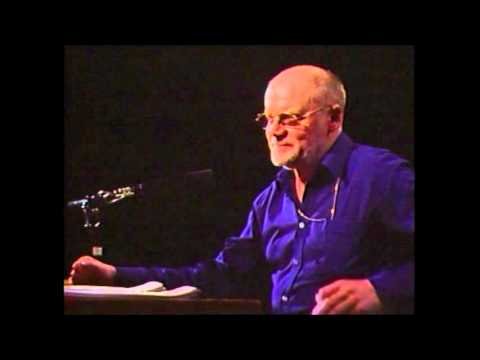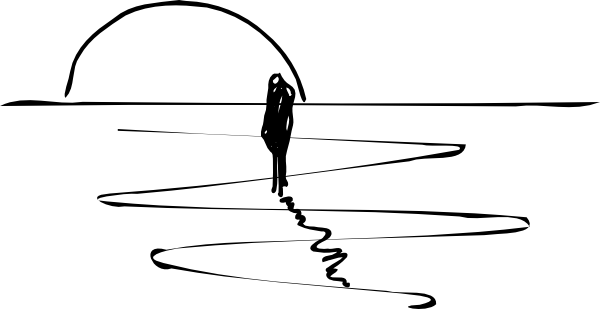„Sobald einer über die Staatsangelegenheiten sagt »Was geht’s mich an?«, muss man damit rechnen, dass der Staat verloren ist.“
(Jean-Jacques Rousseau)
Möglicherweise haftet mir das Etikett an, mich vorrangig mit dem Jazz zu befassen und es mir dabei zur Aufgabe gemacht zu haben, möglichst viele von auf dieser Plattform für jene Musikrichtung zu begeistern. Weder versuche ich mich von dieser Etikettierung zu entledigen, noch an meiner musikalischen Vorliebe für den Jazz etwas zu ändern. Doch gibt dies nur in Bruchstücken das wieder, welches meine eigentlichen Leidenschaften sind. Es sind das unverkrampfte Spiel mit den Worten, entnommen der mir zur Verfügung stehenden Sprachen und meinen Gedankensalat zum lesbaren Geschmackserlebnis werden zu lassen – all dies birgt jenes Elixier in sich, welches (manchmal auch wirre) Fantasien zum Blühen bringt.

Um dabei aber nicht (im Hinblick auf eine realistische Selbsteinschätzung) die Bodenhaftung einzubüßen, greife ich regelmäßig zu den publizierten Texten jener Autoren, die unsere Gesellschaft aufmerksam beobachten und die so gesammelten Erkenntnisse mit unbestreitbarer Liebe zur Weisheit in Worte fassen und (glücklicherweise) meist dabei auch zu Papier bringen. Das Ergebnis ist auch bekannt als »philosophisches Gedankengut«. Eine Frau, der diese Gabe nicht abzusprechen ist, war Hannah Arendt, die sich selbst zwar nie als Philosophin bezeichnete, allerdings alles in sich vereinte, was es braucht, um weise Gedanken für die Ewigkeit zu formulieren.
Hannah Arendt führte von 1950 bis 1975 ein Tagebuch, welches aber nicht wie oft üblich in einer Schublade vergilbte, sondern, eingebettet zwischen zwei Buchdeckeln, unter dem Titel »Denktagebuch« im Buchladen käuflich zu erwerben ist. Beim abendlichen Eintauchen in diese Ansammlung intimer Gedanken kroch in mir die Frage auf, ob es mir überhaupt erlaubt sein könnte, im Gespräch mit meiner Frau und mit Freunden, aus Passagen dieses besonderen Tagebuchs zurückzugreifen oder ob ich mich damit sogleich mit Federn schmücke, die mir nie entwachsen sind?

„Lügen erscheinen dem Verstand häufig viel einleuchtender und anziehender als die Wahrheit, weil der Lügner den großen Vorteil hat, im Voraus zu wissen, was das Publikum zu hören wünscht.“ (Hannah Arendt, 1972 -Die Lüge der Politik)
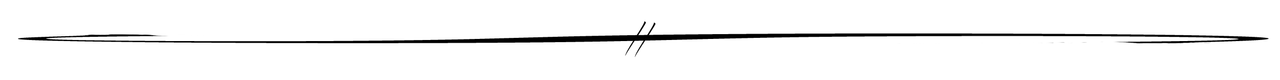

Andererseits werde ich nicht müde, Menschen (wie nah sie mir auch stehen mögen) in verbaler und schriftlicher Form darauf hinzuweisen, von welchem geistigen Abfall sich die Person mit fragwürdiger Machtbefugnis, Tag für Tag (mit dem stabilen Rückhalt einer Abgeordneten-Diät) und ohne Rücksicht auf Konsequenzen befreien darf. Und doch wird all das, wie ein Eintopf mit allem, was einem gerade in die Finger gerät, unter dem Mantel des »Zitats« unter einen Hut gesteckt.
Vielleicht ist es an der Zeit, trotz eines drohenden oder herbeigesehnten Abbaus des bürokratischen Vorschriftzwangs, hier den Hebel anzusetzen und eine Differenzierung einzuführen. Ich stelle Zitate in den Vergleich und ihr dürft per Knopfdruck entscheiden, welcher der Ergüsse ihr in eurem Gedankengut zu speichern gedenkt.
Ein geistiger Orgasmus mit dem Prädikat der Unsterblichkeit oder das geistige Gewäsch, welches den Hauptwaschgang nie erreichte?

„Sprechend und handelnd schalten wir uns in die Welt der Menschen ein, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, und diese Einschaltung ist wie eine zweite Geburt, in der wir die nackte Tatsache des Geborenseins bestätigen, gleichsam die Verantwortung dafür auf uns nehmen.“ - Hannah Arendt
„Wenn wir am Ruder sind, reißen wir alle Windkraftwerke nieder. Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!“ – Alice Weidel
„Zukunft ist keine Dienstleistung, sondern zentrale Aufgabe der Gesellschaft. Sie ist zu wichtig, um sie Regierungen zu überlassen.“ - Jörg Sommer (Sozialwissenschaftler)
„Ich war nicht gut in Rechtschreibung früher und hatte einen leichten Schlag in Richtung Legasthenie.“ - Robert Habeck
„Wenn Freiheit und Demokratie auch keine äquivalenten Begriffe sind, so sind sie doch komplementär: Ohne Freiheit ist die Demokratie Despotie, ohne Demokratie ist die Freiheit eine Chimäre.“ - Octavio Paz (Mexikanischer Schriftsteller)
„Ich gucke nicht rechts und nicht links. Ich gucke in diesen Fragen nur geradeaus.“ - Friedrich Merz

Nun stellt sich erst einmal die Frage, wann überhaupt ein ausgesprochener oder niedergeschriebener Gedanke einen Anreiz dafür bietet, als Zitat konserviert (länger haltbar gemacht) zu werden?
Was bietet sich dabei selbst (wie überteuerte Dubai-Schokolade) an?
- Die prägnante, knappe und pointierte Formulierung.
Vergleichbar jedem medial aufgebauschten Trend, birgt diese Variante allerdings die Gefahr, durch die Fast-Food ähnliche schnelle Verdaulichkeit ohne weitere Überlegungen verschlungen zu werden. Ein anschauliches Beispiel:
„Ich denke, also bin ich.“ – René Descartes
Da das mit dem Denken jedoch nicht mehr sonderlich populär scheint, könnten die Zahlen betreffend der Weltbevölkerung eigentlich drastisch nach unten korrigiert werden? Schulterzucken oder es doch (trotz aller inneren Widerstände) mit dem Denken versuchen?
- Den Moment am Schlafittchen packen und ihm kurzerhand seinen eigenen Stempel aufzudrücken.
„Wir schaffen das.“ – Angela Merkel (Eigentlich gestohlen, da Jahre zuvor bereits jemand stur und steif behauptete: Yes we can)
„We make America great again.“ - Ronald Reagan (von Barry Goldwater, Bill Clinton und Donald Trump übernommen.)
Wenn Hoffnung und Glaube sich kurzerhand von der Realität um Lichtjahre entfernen, kommt es zu solchen Versprechen, deren Haltbarkeitsdatum mit dem Abschalten der Mikrofone erreicht scheint.
Wohl ungewollt – aber dennoch mit einer erheblich längeren Brauchbarkeit ausgestattet:
„Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden.“ – Rosa Luxemburg
„Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“ – Hobbes
Fazit:
„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“
Der »Spruch« könnte von mir stammen, geht allerdings zurück auf Sokrates, der bereits 400 Jahre vor unserer christlich beeinflussten Zeitrechnung in seiner Apologie mit diesem Satz seinen Mangel an Weisheit bekundete.
Diese Erkenntnis gilt seitdem als Beleg dafür, dass der »alte Grieche« es nie bis zum Niederrhein schaffte, um sein Defizit an plausiblen Erklärungen für das Überleben im Allgemeinen aufzustocken. Der Niederrheiner hat nämlich für alles eine Erklärung parat.