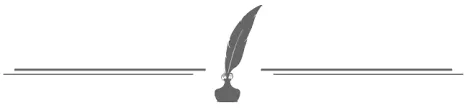Beruf, Familie und was sonst noch kam
Abschnitte und Konserviertes aus dem Leben des Kalle Banich -
Vergitterte Aussichten
Da Kalle Banich seinen Dienst an der Waffe bereits von Kindesbeinen an bis nahe an die Perfektion ausgeübt hatte, dürfte es niemanden verwundern, dass er sich, als der Staat von ihm seine aktive Zuneigung einforderte, für den Zivildienst entschied.
Das Angebot der JVA „Lerchesflur“ in Saarbrücken, den Zivildienst im dortigen Freigängerhaus zu absolvieren, konnte Kalle unter keinen Umständen ablehnen, weil schon seit Jahren eine fast familiäre Bande zwischen den beiden Institutionen bestanden. Einerseits das aus öffentlichen Mitteln finanzierte Grand-Hotel mit schwedischen Gardinen und Dauerüberwachung, andererseits die Familie Banich, die in regelmäßigem Turnus jeweils ein ehrenwertes Mitglied der Familie in die mit Vollpension gebuchte Obhut des Staates übergab.

Es wurden sogar Überlegungen angestellt, ob diese innige Freundschaft nicht mit einer feierlichen Vertragsunterzeichnung oder zumindest mit einem innig und lang andauernden Kuss besiegelt werden sollte. So bekam Kalle während seiner Zivildienstzeit erstmals die Möglichkeit, alle Familienmitglieder an einem Tag begrüßen zu können – und wenn es auch nur an Besuchertagen war.
Trotz all dieser widrigen Umstände hatte Kalle Banich es tatsächlich geschafft, seinen Vater Olle aus dem Endlager „Sauerkraut-Stollen“ zu befreien und ihm eine gut dotierte Stelle als Gefängnis-Psychologe in einem anderen Bundesland zu besorgen.
Aus dem ursprünglichen Vorhaben, den Vater auch in der Saarbrücker Haftanstalt mit langfristigem Arbeitsvertrag in Anstellung zu bringen (schon wegen der so lange vermissten familiären Nähe, wie Kalle ständig betonte), wurde leider nichts, denn Ida Banich ließ ihren Mann, nach dessen gewaltsamer Befreiung und anschließendem Abtauchen in die vorübergehende Unauffindbarkeit, steckbrieflich suchen.
Die Belohnung zur Ergreifung des nimmermüden Samenspenders setzte der damals bereits signifikant reduzierte Familienrat fest. Verkleinert aus dem Grund, weil Kalle zur Zeit der Entscheidung im Dienst weilte, bei dem er auch zwei seiner Brüder auf längere Zeit in seiner Nähe wusste.
Ein halbes Schwein und fünf Kästen Bier (sollte man den Angaben auf dem selbst entworfenen Fahndungsplakat Glauben schenken) wurden dem versprochen, der den Zeugungskünstler wieder zurück zwischen die Einmachgläser und das Sauerkrautfass brächte.
Natürlich, das wusste auch Ehefrau und Clanchefin Ida, war aus der Nachbarschaft keine Hilfe zu erwarten. Die hatten Olle seit Kalles Geburt nicht mehr gesehen und auch nicht wirklich vermisst. Aber die, die sich noch vage an ihn erinnern konnten, waren einhellig überzeugt, dass Olle Banich, der einzige dieses Ensembles war, von dem man sich vorbehaltlos die Schuhe hätte schnüren lassen können. So vertraute Ida Banich ganz auf das Gespür ihres halb kriminellen Packs.

Kaum war das erste Fahndungsplakat an die Kellertür genagelt, verzogen sich drei der Brüder in die einzige Kneipe vor Ort, in der ihnen noch kein Lokalverbot erteilt wurde. Es ging einzig und allein darum, die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Nachdem das zweite Dutzend Pils dem Durst der Brüder zum Opfer gefallen war, lag auch ein Schlachtplan für die nahe Zukunft vor.
Um jedoch das Gasthaus einigermaßen legal verlassen zu können, wurde der Wirt, der den finanziellen Gegenwert der vertilgten Flüssigkeit vehement einforderte, mit der Anweisung hinter seinen Zapfhahn gejagt, die Rechnung gefälligst an Ida Banich zu senden. In die Betreffzeile der Zahlungseinforderung sei einzutragen: betrifft Finderlohn.
Mama hatte schließlich fünf dieser Kästen, bei eigener Kostenübernahme, in Aussicht gestellt.
Nur wenig später musste die Gartenlaube von Herrn Mattuschek eine kleine Feuertaufe durchlaufen, da halbe Säue nicht über offenem Feuer, sondern nur über einer kräftigen Glut gegart werden sollten.
Als die Gartenlaube endlich richtig fackelte, machten sich drei alkoholisierte Fahnder auf die Suche. Selbstverständlich nicht nach Vater Olle, sondern nach Tina, der Ferkelsau aus dem Besitz von Landwirt Alfred Huber.
Dies schien den drei Schwachköpfen auch die einzig logische Konsequenz, wenn der Begriff ‘Schlachtplan’ richtig definiert werden sollte. Die drei geistigen Kriechtiere klammerten sich an die irrationale Hoffnung, sie könnten bei Bauer Huber, mit 2,1 Promille Alkohol im Handgepäck, in den Stall einlaufen, dem Ferkel kurz über den Kopf streicheln und das überaus sensible Tier mit Aussicht auf ein wärmendes Lagerfeuer aus dem Stall locken.

Das einsetzende Gequieke rief nicht nur Alfred Huber, sondern auch noch die örtliche Polizei auf den Plan. Die sorgfältig ausgearbeitete Strategie mutierte innerhalb weniger Sekunden zu einem eindimensionalen Desaster. Das Schlachten wurde rigoros gestrichen und auf die Warteliste verschoben. Die freiwillige Feuerwehr konnte sogar noch alle Gartenzwerge und den Mikrowellenherd aus Herrn Mattuscheks Gartenlaube vor den Flammen retten.
Die Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht, anberaumt für den 12. März des gleichen Jahres, sollte darüber entscheiden, wie stabil vergittert die zukünftigen Liegestätten der drei Banichs sein sollten. Doch wo immer der Clan geballt auftrat, lief es meist nicht ganz so, wie der Organisator der Veranstaltung es im Vorfeld geplant oder sich zurechtgelegt hatte. So stand die ganze Verhandlung mehr oder weniger im Zeichen der Zeugen Ida und Kalle Banich.
Ida Banich, weder vom Richter noch vom Anwalt ihrer Söhne unter Kontrolle zu bringen, forderte lautstark zunächst die Unterbrechung der Beweisaufnahme, weil jetzt bereits klar zu erkennen sei, dass die Staatsanwaltschaft über keinerlei Indizien, die eine Verwicklung ihrer Söhne in kriminelle Machenschaften belegen könnten.
Kalle Banich, über das rigorose Verhalten seiner Mutter sichtlich erstaunt, versuchte nun zu retten, was noch zu retten war. Doch, der unter Berücksichtigung des hohen sozialen Engagements, das Kalle in der JVA zeigte, gestellten Frage des Richters, welche positiven Veränderungen er sich von einem längeren Gefängnisaufenthalt seiner Brüder erhoffe, blieb er die Antwort schuldig. Denn, bevor Banich junior überhaupt nachdenken konnte, hing plötzlich der Bürgermeister, Johann Merzig, am Tisch des Richters.
Dieser hatte sich bis zu jenem Zeitpunkt der Verhandlung ganz dezent zwischen den vielen Beobachtern im Hintergrund gehalten. Doch jetzt, da Kalle Banich in eine kurze Phase des Nachdenkens versunken war, griff er beherzt die günstige Gelegenheit beim Schopfe und überreichte dem Richter eine zwanzigseitige Petition.
Etwas peinlich für Merzig, aber für viel Erheiterung im Saal sorgend, war der Umstand, dass der Bürgermeister auf seinem Weg zum Richtertisch Ida Banichs ausgestreckten Beine übersah. Dies wiederum hatte in der Folge schmerzhafte Auswirkungen auf seinen Unter- und Oberkiefer, da der Bürgermeister es genau diesen sonst so beweglichen Teilen des menschlichen Körpers zu verdanken hatte, nicht der Länge nach auf die blank polierten Holzdielen aufzuschlagen. Es war einzig und allein der Mundpartie vorbehalten, das Gewicht des stürzenden Mannes an der Tischkante abzufangen.
Anstatt in allerletzter Sekunde noch beide Hände den stark bedrohten Zahnreihen helfend zur Seite zu stellen, klammerten sich diese eisern an die abzugebende Petition. Wie er dort so in der Halbschräge hing, den Oberkiefer fest im lackierten Holz verankert, beide Arme auf der Tischplatte und die Hände in beschriftetes Papier verkrallt, kam schon dem Vergleich zur Tragik-Komödie nahe. Der Richter nahm stirnrunzelnd seine Lesebrille von der Nase und bat den Überbringer wichtiger Nachrichten, jetzt doch wieder nach einem festen Stand auf seinen Beinen zu suchen.

Plötzlich mit einer unüberhörbaren Sprachstörung behaftet, bat der Bürgermeister das Gericht, einen genaueren Blick in die bedruckten Papiere zu werfen.
Wer, außer dem Richter, noch das Nuscheln des Bürgermeisters verstehen konnte („Die Petition sei schließlich von achtundneunzig Prozent der ortsansässigen Bevölkerung unterzeichnet worden.“) spielte keine Rolle, da der Richter spontan die Aufgabe des Übersetzers übernahm. Der Herr in schwarzer Robe blätterte kurz durch die vorgelegten Seiten und informierte anschließend Staatsanwalt sowie Verteidiger über das Ersuchen der Bevölkerung.
Achtzehn Seiten waren lediglich mit Unterschriften gefüllt. Die Adressen des Gerichtes und des Initiators der Petition beanspruchten eine Seite. Der eigentliche Text des Anliegens füllte ganze drei Zeilen:
Wir verlangen, dass sechs der sieben Banich-Brüder lebenslang hinter dem Eisernen Vorhang oder zumindest hinter Gitterstäben verschwinden.
Der siebte Banich soll am Samstagmorgen auf dem Markt geteert und gefedert werden.

Noch eine Anmerkung des Autors:
Sollte jemand mit der Idee im Hinterkopf aufwachen, die Geschichte um Kalle Banich ausdrucken zu lassen und anschließend festlich geschnürt Onkel Max zum Geburtstag zu schenken, den bitte ich, erstens auf die Quelle hinzuweisen und zweitens den Onkel davon abzuhalten, sein Geschenk in die Redaktionsstube des Magazins der „Taubenfreunde Oberhausen“ weiterzuleiten – oder wohin auch immer? Stichwort Copyright.